Behandlungsangebot
Wenn Sie unter
Depressionen, Erschöpfungszuständen (Burn-Out)
Anpassungsstörungen nach besonderen Lebensereignissen (z.B. Trennung, Verlusterfahrungen, bedrohliche Erkrankung etc.)
allen Arten von Ängsten (spezifische Phobien, soziale Phobie, generalisierte Angststörung)
Zwangsstörungen
Essstörungen
Posttraumatischen Belastungsstörungen
Schmerzen bei psychischer Beeinflussung
Somatoformen Störungen
Persönlichkeitsstörungen
und damit einem krankheitswertigen und behandlugsbedürftigen Zustand leiden, dann biete ich Ihnen Unterstützung und Behandlung in Form einer videogestützten Psychotherapie.


Ihre möglichen Behandlungsziele hierbei könnten sein:
- Symptomreduktion
- Gewinnen eines ganzheitlichen Bildes von sich selbst
- Verständnis für die eigene Vergangenheit
- Einen positiveren Ausblick auf die eigene Zukunft, die Bildung neuer Ziele und Perspektiven
- Fördern von Ressourcen zur Problem- und Krankheitsbewältigung
- Selbtwertstabilisierung und einen wohlwollenderen, nachsichtigeren Umgang mit der eigenen Person entwickeln
- Akzeptanz für einen möglicherweise bleibenden Zustand (wie eine chronische Erkrankung) entwickeln
- Rückfallprophylaxe
Mein therapeutisches Behandlungsangebot umfassst Psychotherapie sowohl in Präsenz als auch onlinebasiert. Insbesondere in der Anfangsphase einer (Online-)Therapie kann es aus diagnostischen Gründen sinnvoll und für den Beziehungsaufbau auch wünschenswert sein, Sitzungen in Person wahrzunehmen. Je nach therapeutischem Behandlungsbedarf können weitere Sitzungen, mitunter der gesamte therapeutische Prozess dann onlinebasiert erfolgen.
Wie läuft so eine Psychotherapie überhaupt ab?
Die Psychotherapie startet mit einem Erstgespräch, das dem gegenseitigen Kennenlernen dient und in dem Raum für die Schilderung des Anliegens und der aktuellen Beschwerden ist. Im Anschluss an dieses erste Gespräch finden dann bis zu fünf probatorische Sitzungen statt, in denen dann auch der bisherigen Krankheitsgeschichte und vor allem auch Ihres bisherigen Werdegangs Aufmerksamkeit geschenkt wird. Nebst einer ersten diagnostischen Einordnung der Beschwerden und der Feststellung, inwiefern es sich um eine psychische Erkrankung handelt, die mithilfe einer Psychotherapie zu behandeln ist, werden wir gemeinsam erörtern, inwiefern eine (onlinebasierte) Psychotherapie zur Behandlung erfolgsversprechend erscheint und inwiefern die tiefenpsychologische Zugangsweise für Sie passend ist. Diese ersten Sitzungen, die noch keiner Beantragung bei der Krankenversicherung bedürfen, bieten Ihnen als PatientIn die Möglichkeit, erst einmal zu schauen, ob Sie sich auf eine Therapie einlassen können, ob die Chemie zwischen Ihnen und mir stimmt und ob Sie einen längerfristigen gemeinsamen Therapieprozess aufnehmen möchten.
Wenn Sie über die ersten Sitzungen hinweg das Gefühl gewonnen haben, dass Sie von einer Psychotherapie mit mir profitieren können und sich Ihr Anliegen auf die Bewältigung recht spezifischer, klar umrissener gegenwärtiger Probleme oder Herausforderungen oder einen besseren Umgang mit Symptomen konzentriert, so bietet sich die Aufnahme einer Kurzzeittherapie an. Diese umfasst zwischen 12 und 24 Sitzungen und muss meist vor Beginn durch mich als Psychotherapeutin bei der privaten Krankenversicherung beantragt werden. Das Antragsverfahren untercheidet sich von Krankenversicherung zu Krankenversicherung, weswegen es sinnvoll ist, wenn Sie sich vorab hierüber bei Ihrer privaten Krankenversicherung zum Prozedere informieren.
Bei tiefergehenden oder chronischen psychischen Problemen, wenn mehrere psychische Erkrankungen vorliegen und sich gegenseitig beeinflussen oder eine längerfristige Beziehungsarbeit zur Behandlung erforderlich ist, so kann eine Langzeittherapie bei der privaten Krankenversicherung beantragt werden. Diese umfasst in aller Regel 60 Sitzungen und kann im begründeten Fall einer weiteren Behandlungsbedürftgikeit bis auf 100 Sitzungen ausgeweitet werden.
Private Krankenversicherung
Private Versicherungen zahlen abhängig vom individuellen Versicherungsvertrag die Kosten einer ambulanten Psychotherapie vollständig oder anteilig. Die Abrechnung erfolgt nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) bzw. nach der an diese angelehnte Gebührenordnung für PsychotherapeutInnen (GOP). Die ersten fünf Termine gelten als probatorische Sitzungen, wofür von privaten Krankenkassen im Regelfall ohne Antragsverfahren die Kosten übernommen werden. Danach ist in den meisten Fällen ein Antrag auf Psychotherapie bei Ihrer privaten Krankenkasse zu stellen, den ich als Ihre Psychotherapeutin dann für Sie verfassen würde.
Detailliertere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den nachstehenden Textpassagen, die das genaue Vorgehen für Sie hoffentlich verständlicher machen können.
Sicherlich wissen Sie, dass (anders als bei gesetzlich Versicherten) mit Ihnen als PrivatpatientIn ein direkter privat- rechtlicher Vertrag zustandekommt, welcher vor Behandlungsbeginn zwischen Ihnen und mir als Behandler vereinbart wird.
Mit entsprechendem Vertragswerk, welcher sowohl die Honorarvereinbarung, Ausfallregelungen als auch weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen von Psychotherapie beinhaltet, können Sie sich schon einmal vertraut machen:
Informationen & Rahmenbedingungen der Psychotherapie (Präsenz & Online)
Dadurch sind Sie als PrivatpatientIn selbst in der Verantwortung, sich um die Erstattung zu kümmern und falls diese je nach abgeschlossenem Vertrag mit den Versicherungen nur anteilig erfolgt, für eine etwaige Zuzahlung aufzukommen.
Checkliste für Privatversicherte
Um eine möglichst vollständige Erstattung durch Ihre PKV zu ermöglichen, empfiehlt es sich daher für Sie als PrivatpatientIn, vor Therapiebeginn folgende Fragen durch Kontaktaufnahme mit der privaten Krankenkasse abzuklären:
Ist eine Psychotherapie im Leistungsumfang des Vertrags enthalten?
Falls ja, wieviele Therapiestunden pro Jahr sind vorgesehen?
Werden die Kosten von der Versicherung voll oder evtl. nur anteilig erstattet?
Welche Unterlagen werden für die Antragstellung benötigt? Wird für die Durchführung einer Kurzzeittherapie bereits ein Antrag benötigt? Ist ein Bericht an die/den GutachterIn notwendig?
Gibt es Erstattungseinschränkungen?
Weisen Sie Ihre PKV bitte hierneben darauf hin, falls die Behandlung als Online-Therapie durchgeführt werden sollte. Dies stellt in aller Regel angesichts der geltenden neuen Regelungen kein Problem dar.
Verweisen Sie dabei gerne auf folgende Regularien:
Private Krankenversicherung ermöglicht dauerhaft Videosprechstunden in der Psychotherapie. Zum 1. Januar 2022 entstand eine dauerhafte Grundlage für die psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten von Privatversicherten mittels Videoübertragung (s. PKV-Verband Pressemitteilung).
Oder auch: Private Krankenversicherung und Beihilfe ermöglichen dauerhaft Videosprechstunden in der Psychotherapie. Für die Erbringung telemedizinischer Leistungen im Rahmen der Behandlung von psychischen Erkrankungen mit Versicherten der PKV und Beihilfe gilt ab dem 1.1.2022 eine Gemeinsame Abrechnungsempfehlung der Bundespsychotherapeutenkammer, dem Verband der Privaten Krankenversicherung und den Beihilfestellen von Bund und Ländern (s. DPTV Meldung & BPtK Abrechnungsempfehlung.pdf).
Die Honorarstellung richtet sich dabei nach der Gebührenordnung der Psychologischen Psychotherapeuten (GOP). Weisen Sie Ihre Krankenversicherung bitte bereits darauf hin, dass die Abrechnung entsprechend nachfolgender neuer Regelungen (Abrechnungsempfehlungen) erfolgen wird, was ebenso wenig ein Problem für die Erstattung darstellen sollte (s. Gemeinsame Abrechnungsempfehlungen der Bundesärztekammer, der Bundespsychotherapeutenkammer, des Verbandes der Privaten Krankenversicherung und der Beihilfeträger von Bund und Ländern zur Erbringung neuer psychotherapeutischer Leistungen, Geltung ab 01.07.2024).
Für welche psychotherapeutischen Behandlungen und in welchem Umfang die private Krankenversicherung aufkommt, ist von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich und hängt von Ihrem individuell abgeschlossenen Versicherungsvertrag ab. Die private Krankenversicherung deckt nur solche Psychotherapie-Behandlungen ab, die in Ihrem Versicherungsvertrag ausdrücklich aufgeführt sind. Dabei ist der gewählte Krankenversicherungstarif bestimmend für den Erstattungsumfang.
Nehmen Sie daher bitte vor Aufnahme der Therapie Kontakt zu Ihrer PKV auf und orientieren Sie sich dabei gerne an oben stehender Checkliste (Download).
Beihilfe/ Heilfürsorge
Die Beihilfe ist das eigenständige Krankensicherungssystem für Beamte und Richter. Für Soldaten – und teilweise Beamte in den Vollzugsdiensten – kann die Krankensicherung auch in Form der sog. (freien) Heilfürsorge oder truppenärztlichen Versorgung ausgestaltet sein. Das Beihilfesystem umfasst die Aufwendungen des Dienstherrn im Rahmen der Fürsorgepflicht für Krankheits-, Pflege- und Geburtsfälle sowie bei Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten und Schutzimpfungen. Die Leistungen werden ergänzt durch die Eigenvorsorge des Beamten, die aus den laufenden Bezügen zu bestreiten ist. M.a.W. die Beihilfe übernimmt dabei einen Anteil der Krankheitskosten (50 %, 70 % oder 80 %), während der oder die Beihilfeberechtigte für den restlichen Teil eine (in aller Regel) private Krankenversicherung abschließt. Leistungen des eigenständigen Beihilfesystems erfolgen im Gegensatz zum grundsätzlichen Sachleistungsprinzip der GKV als Kostenerstattung. Der Beamte, der nicht freiwillig gesetzlich versichert ist, erhält eine Rechnung als Privatpatient, begleicht diese und bekommt die beihilfefähigen Aufwendungen entsprechend dem Beihilfebemessungssatz (50 %, 70 % oder 80 %) vom Dienstherrn erstattet.
Die folgenden psychotherapeutischen Leistungen sind bei der Beihilfe antrags- und genehmigungsfrei:
- die Sprechstunde (bis zu 6 Sitzungen à 25 Minuten oder 3 Sitzungen à 50 Minuten)
- die Probatorik (bis zu 5 Sitzungen à 50 Minuten vor Beginn einer Therapie bzw. als erste Phase der Therapie)
- die Kurzzeittherapie (bis zu 24 Sitzungen à 50 Minuten)
- die Akutbehandlung (bis zu 24 Sitzungen à 25 Minuten oder 12 Sitzungen à 50 Minuten)
- Eine Langzeittherapie (> 24 Sitzungen) ist jedoch antrags- und genehmigungspflichtig. Spätestens bei dieser Beantragung, ggf. auch schon früher, ist die Einholung eines ärztlichen Konsiliarberichts (somatische Abklärung) erforderlich.
Einen umfassenden Überblick über die aktuellen Bestimmungen finden Sie exemplarisch bei der Bezirksregierung Düsseldorf.
Bitte achten Sie darauf, sich an Ihre zuständige Beihilfestelle zu wenden. Diese ist abhängig von der Dienststelle der beihilfeberechtigten Person und kann dem jeweils letzten Beihilfebescheid entnommen werden.
Bitte klären Sie vor Beginn der Psychotherapie die Übernahmebedingungen mit der für Sie zuständigen Beihilfestelle ab. Orientieren Sie sich hierbei gerne an oben stehender Checkliste (für Privatversicherte).
Bundespolizei / Bundeswehr
Zur Privatbehandlung von Bundespolizisten:
Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hat einen Vertrag mit dem Bundesinnenministerium geschlossen. Polizisten der Bundespolizei können sich an psychotherapeutische Privatpraxen wenden. Kostenträger ist die Heilfürsorgestelle Bundespolizei im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin. Klären Sie bitte nichtsdestotrotz vorab die Rahmenbedingungen einer Kostenübernahme ab.
Zur Kostenerstattung über die Bundeswehr:
Die Kosten einer Psychotherapie für Soldaten der Bundeswehr werden in der Regel von der Bundeswehr übernommen, auch für die Behandlung in einer Privatpraxis. SoldatInnen müssen zum ersten Termin den „Sanitätsvordruck Kostenübernahmeerklärung“ (San/BW/0218) mitbringen. Auf dieser Grundlage werden die probatorischen Sitzungen abgerechnet. Für die weitere Behandlung wird ein Antrag beim Truppenarzt gestellt.
Selbstzahler
Für Selbstzahler*innen bemisst sich das Honorar ebenfalls an der Gebührenordnung für PsychotherapeutInnen (GOP). Der Vorteil einer Behandlung auf Selbstzahlerbasis ist die über die allgemeine Schweigepflicht hinausgehende Privatsphäre und Diskretion hinsichtlich der psychischen Beschwerden. Die Krankenkasse erhält keine Informationen zu Ihren psychiatrischen Diagnosen, welche Auswirkungen auf Versicherungen (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung) oder Verbeamtung haben könnten. Hierneben sparen Sie sich den mit der Kostenerstattung einhergehenden bürokratischen Aufwand und haben maximale Selbstbestimmung in der Termingestaltung bzw. dem Umfang der Therapie.
In diesem Fall besteht ein Behandlungsvertrag zwischen Ihnen und mir als Therapeutin und alle weiteren Formalitäten entfallen. Mit diesem Vertrag können Sie sich hier schon einmal vertraut machen:
Berufsgenossenschaften
Durch die Berufsgenossenschaften und andere Unfallversicherungsträger ist leider keine Erstattung der Psychotherapie möglich, da diese Träger die Kosten für Psychotherapien nur dann erstatten, wenn diese von PsychotherapeutInnen durchgeführt werden, die einen Vertrag mit der Deutschen Unfallversicherung (DGUV) abgeschlossen haben und am Psychotherapeutenverfahren teilnehmen.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Therapie auf Selbstzahlerbasis in Anspruch zu nehmen.
Gesetzliche Krankenversicherung
Sollten Sie gesetzlich versichert sein und derzeit keinen freien Therapieplatz in einer Kassenpraxis finden, kann eine Behandlung in meiner Privatpraxis im Rahmen der Kostenerstattung möglich sein.
Um Sie bei diesem formalen Verfahren zu entlasten, arbeiten wir mit dem Dienstleister Tepavi zusammen.
Tepavi unterstützt Sie dabei umfassend und übernimmt alle Schritte, die rechtlich übertragbar sind und erzielt eine schnellere Bewilligung sowie höhere Bewilligungsquoten bei minimalem Aufwand:
Organisation eines Sprechstundentermins basierend auf Ihren zeitlichen Möglichkeiten
Kommunikation mit der Terminservicestelle (TSS)
Kontaktaufnahme mit Psychotherapeut:innen mit Kassensitz zur Erstellung der erforderlichen Absageliste
Kommunikation mit der Krankenkasse
Überprüfung Ihrer Unterlagen auf Vollständigkeit und formale Richtigkeit
Einreichung des Antrags bei der Krankenkasse
Falls nötig: Abwicklung des Widerspruchsverfahrens über kooperierende Fachanwälte
Weitere Informationen erhalten Sie im Gespräch mit mir sowie direkt bei Tepavi.
Es besteht natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, die Therapie auf Selbstzahlerbasis in Anspruch zu nehmen. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Was bedeutet tiefenpsychologisch-fundiert?
Das tiefenpsychologische Therapieverfahren ist wissenschaftlich und sozialrechtlich anerkannt, d.h. von den Krankenversicherungen als sog. Richtlinienverfahren zur Behandlung einer psychischen Erkrankung als wirksam erachtet und daher prinzipiell erstattungsfähig (siehe Menüpunkt Kosten). Es handelt sich um ein psychodynamisches Behandlungskonzept, was so viel bedeutet, dass die Tiefenpsychologie ihre theoretischen Grundannahmen mit den analytischen Therapieverfahren teilt.
In einer tiefenpsychologisch-fundierten Psychotherapie werden persönliche Krisen und die Entwicklung psychischen Leidens als Ausdruck bzw. als Folge nicht bewältigter verletzender Beziehungserfahrungen, unzureichend ausgebildeter psychischer Bewältigungskompetenzen und innerer (oft unbewusster) Konflikte früherer Lebensphasen verstanden. Diese erschweren dann im Hier und Jetzt, d.h. in der aktuellen Lebenssituation die Bewältigung der anstehenden Herausforderungen oder die Lösung von gegenwärtigen Beziehungskonflikten, hierdurch kann es zur Ausbildung belastender psychischer Symptome bzw. Erkrankungen kommen.
Ziel der Behandlung ist es, die den aktuellen Beschwerden zugrundeliegenden unbewussten Motive und Konflikte gemeinsam zu erkunden und sich mit diesen auseinanderzusetzen. Durch ein besseres (emotionales) Verständnis dieser Konflikte bzw. widerstreitenden Kräfte im Inneren sowie ihrer (unbewussten) Zusammenhänge mit den gegenwärtigen Problemen kann Entlastung geschaffen und Veränderungen im aktuellen Erleben und/oder Verhalten erreicht werden. Manchesmal bedeutet dies auch, vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen und Erlebnisse mit sich einen wohlwollend-nachsichtigeren Umgang finden und zu einem ganzheitlicheren Bild der eigenen Person kommen zu können. Da in der Entstehungsgeschichte unbewusster Konflikte oder belastender früherer Erfahrungen zumeist Erlebnissen innerhalb von zwischenmenschlichen Beziehungen eine zentrale Bedeutung zukommt, spielt die therapeutische Beziehung im Sinne einer positiven korrigierend (heilsam wirkenden) Erfahrung für die Psychotherapie eine maßgebliche Rolle.
Wer profitiert von einer online-basierten Therapie besonders?
Besonders geeignet ist eine Online-Therapie, wenn Sie:
- viel unterwegs sind und nicht die Möglichkeit besteht, wöchentliche Termine an Ihrem Wohnort wahrzunehmen.
- sich aufgrund einer Erkrankung oder Ihrer aktuellen Lebenslage nicht in der Lage fühlen, persönlich zu einer Behandlung oder Beratung zu erscheinen bzw. anzureisen.
- die damit verbundene räumlich-zeitliche Flexibilität schätzen.
- Sie auf einen Termin für eine Therapie vor Ort lange warten müssten.
- noch nicht genau wissen, ob Sie professionelle Hilfe brauchen.
- (vielleicht aufgrund sozialer Ängste oder aus Schamgründen) unsicher sind, wie sich das anfühlt, mit einem/r TherapeutIn über die eigenen Probleme zu sprechen und Ihnen auf diese Weise die Kontaktaufnahme und das Hilfeersuchen leichter fällt.
ONLINE-THERAPIE WIRKT!
Eine große Metastudie (Andersson & Titov, 2014) kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass Online-Therapie und die Präsenz-Behandlung in ihrer nachhaltigen Wirksamkeit gleichwertig sind.
Weitere Studien (Literaturangaben zur Vertiefung finden Sie unten auf dieser Seite) belegen, dass sich eine tragfähige und positive therapeutische Beziehung auch digital entwickeln kann. Viele PatientInnen erleben die therapeutische Beziehung bei Online-Therapien als ähnlich unterstützend und persönlich wie in einem unmittelbaren Kontakt. Die Ergebnisse legen nahe, dass für viele PatientInnen die Vertrauensbeziehung zum TherapeutIn, dessen/deren Kompetenz und Arbeitsweise entscheidender sind als das Setting (online oder in einem Raum).
Für viele psychische Erkrankungen konnte die Wirksamkeit von Psychotherapie im digitalen Setting bereits nachgewiesen werden. Am besten belegt ist sie für depressive Erkrankungen und Angststörungen. Nachweise für die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS), chronischer Schmerzen sowie von Schlaf-, Ess- und Zwangsstörungen liegen mittlerweile ebenfalls vor.
Jedoch hat jedes Setting seine Grenzen…
Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass die Möglichkeiten, in akuten Krisensituationen adäquat einzugreifen, bei Online-Angeboten eingeschränkt sind. Daher kommt der Aufstellung eines Krisenplans eine besondere Bedeutung bei, wenn krisenhafte Phasen nicht auszuschließen oder gar erwartbar sind. PatientInnen mit einer Schizophrenie und / oder von Beginn an bestehenden suizidalen Krisen sowie der Neigung zu selbstverletzendem / -schädigendem Verhalten sind aus diesem Grund besser in einer Präsenz-Therapie aufgehoben laut bisheriger Studienlage.
Da meine bisherige therapeutische Erfahrung sich mit dieser Studienlage deckt, biete ich keine Online-Psychotherapie an bei:
- Akuter Suizidalität & Neigung zu selbstverletzendem/ -schädigendem Verhalten
- Akuten Traumatisierungen
- Hirnorganischen Störungen
- Schizophrenen Erkrankungen/ akuten Psychosen
- Abhängigkeitserkrankungen, wenn die Abstinenzdauer weniger als ein Jahr beträgt
Quellen, Literaturempfehlungen zur Vertiefung bei Interesse:
Andersson G, Titov N. Advantages and limitations of Internet-based interventions for common mental disorders. World Psychiatry. 2014 Feb;13(1):4-11. doi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24497236/. PMID: 24497236; PMCID: PMC3918007.
Batastini, A. B., Paprzycki, P., Jones, A.C.T., MacLean, N. Are videoconferenced mental and behavioral health services just as good as in-person? A meta-analysis of a fast-growing practice, Clinical Psychology Review, Volume 83, 2021,101944, ISSN 0272-7358, https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101944.
Ebert, David & Baumeister, Harald. (2020). E-Mental Health: Internet- und mobilbasierte Interventionen in der Psychotherapie. https://www.researchgate.net/publication/350693906_E-Mental_Health_Internet-_und_mobilbasierte_Interventionen_in_der_Psychotherapie.
Eichenberg, Christiane (2013). Internetbasierte Interventionsprogramme bei Depression: Vergleichbare Effektgrößen wie herkömmliche Therapie. Deutsches Ärzteblatt, Heft 8, S. 36-367, August 2013.
Friesenhahn, Johanna & Miles, Taylor (2019). Chancen und Grenzen von Online-Coaching. Eine Studie zu digitalen Kompetenzen und ihrer Wirksamkeit. In: Coaching Magazin 2019/3, S. 33-37.
Hartmann, C. Interview 08.01.2021. »Psychotherapie per Video wirkt ähnlich gut wie Therapie vor Ort« . https://www.spektrum.de/news/fernbehandlung-psychotherapie-per-video-wirkt-aehnlich-gut-wie-vor-ort/1816145#.
Therapie.de: Aktuelle Informationen zum Thema Online-Therapie / Online-Beratung finden Sie unter nachstehendem Link: https://www.therapie.de/psyche/info/therapie/online-therapie/definition-und-formen/.
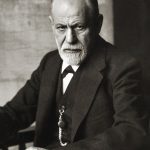
Psychologische Beratung
Bei einer psychologischen Beratung stehen aktuelle Belastungen, Wünsche nach persönlichen Veränderungen, gegenwärtige Herausforderungen und Entscheidungsprozesse im Vordergrund, jedoch keine diagnostizierte(n) psychische(n) Erkrankung(en). Im Kontext einer Beratung dürfen weder psychiatrische Diagnosen gestellt noch psychische Erkrankungen behandelt werden.
Mögliche Themen einer Beratung könnten beispielsweise sein: familiäre Konflikte, herausfordernde Lebensphasen, der Umgang mit Krankheiten oder veränderten Lebensumständen oder schwierige Entscheidungssituationen wie Klärung des eigenen Kinderwunsches, Hauskauf -ja/nein- oder eine innere Dilemmasituation wie die Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch.

Zunächst werde ich mit Ihnen gemeinsam Ihr Anliegen, d.h. Ihren Auftrag, an mich, klären und Ihr Ziel für die Beratung erarbeiten. Anschließend werden mögliche Strategien und Lösungswege, mit denen Sie Ihr Ziel oder den gewünschten Zielzustand erreichen können, erarbeitet.
Manchesmal geht es dabei auch um den Erwerb neuer kommunikativer Strategien, um sich im Austausch mit anderen z.B. besser selbstbehaupten oder besser abgrenzen zu können.

Beratungen (wie auch Coachings) stellen immer Selbstzahlerleistungen dar und werden Ihnen privat in Rechnung gestellt. Da es sich hierbei nicht um eine Heilbehandlung handelt, sind diese nicht über die privaten Krankenversicherungen erstattungsfähig.
Je nachdem, in welchem Lebensbereich man sich beraten lässt, kann man die Kosten dafür aber unter Umständen steuerlich geltend machen (z.B. bei beruflichem Coaching) oder der Arbeitgeber beteiligt sich an den Kosten. Behörden, z.B. die Arbeitsagentur, verordnen zuweilen auch psychosoziale Beratung. In diesen Fällen übernimmt die Behörde die Beratungskosten.
Paarberatung/Paartherapie
Eine Paarberatung kann sinnvoll sein, wenn ein oder beide Partner mit dem aktuellen Miteinander unzufrieden ist bzw. sind. Bedingt kann dies sein durch immer wiederkehrende Konfliktthemen, Verletzungen, Kränkungen, Enttäuschungen, unterschiedliche Ansichten oder Erwartungen, Wünsche, die unvereinbar erscheinen, nicht offen kommuniziert oder dem anderen zuliebe immer zurückgestellt werden, veränderte Lebensumstände wie die Geburt eines Kindes oder finanzielle Sorgen, aber auch durch Erkrankungen des einen oder beider Partner.
Hierneben sind Vertrauensprobleme, mangelnde oder destruktive Kommunikationsmuster, fehlende gemeinsame Interessen, unerfüllte sexuelle Wünsche oder Außenbeziehungen (Affären) des einen oder beider Partner häufig Gegenstand und Anlass einer Paartherapie. Es kann aber durchaus auch um eine Begleitung der Trennungsphase und damit der Loslösung aus der Beziehung gehen.

Meiner psychodynamischen Arbeitsweise und therapeutischen Haltung entsprechend stehen in Paargesprächen die Interaktionsmuster und die Beziehungsdynamik sowie deren Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten beider Partner im Mittelpunkt. Nebst der wahrgenommenen Paarprobleme soll Raum für persönliche und gemeinsame Wünsche an die Paarbeziehung geschaffen werden, sodass mehr Verständnis für die Perspektive des Anderen entstehen kann.
Entwicklungschancen, konstruktive Lösungsansätze, eine wertschätzende und wohlwollende Kommunikationsweise sowie nutzbare Ressourcen und Bewältigungskompetenzen jedes Einzelnen und des Paares als Ganzes werden gemeinsam erarbeitet und Sie werden bei der Umsetzung in Ihren gemeinsamen Alltag mit all den aufkommenden Hürden und Schwierigkeiten begleitet.

Paarberatungen/ -therapien stellen immer Selbstzahlerleistungen dar und werden Ihnen privat in Rechnung gestellt. Da es sich hierbei nicht um eine Heilbehandlung handelt (also die Behandlung einer psychischen Störung mit Krankheitswert, selbst wenn einer oder beide PartnerInnen unter einer seelischen Erkrankung leiden, deren Behandlung aber nicht Fokus der Paarberatung ist), sind diese nicht über die (privaten) Krankenversicherungen erstattungsfähig.
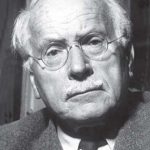
Coaching

Zunächst werde ich mit Ihnen gemeinsam Ihr Anliegen, d.h. Ihren Auftrag, an mich, klären und Ihr Ziel für das Coaching erarbeiten. Anschließend werden mögliche Strategien und Lösungswege, mit denen Sie Ihr Ziel oder den gewünschten Zielzustand erreichen können, erarbeitet.
Manchesmal geht es dabei auch um den Erwerb neuer kommunikativer Strategien, um sich im Austausch mit anderen z.B. besser selbstbehaupten oder besser abgrenzen zu können.
Da keine psychischen Erkrankungen bzw. Leiden mit Krankheitswert im Kontext eines Coachings behandelt werden und es sich damit auch nicht um eine Heilbehandlung handelt, werden die Kosten für ein Coaching weder von den gesetzlichen noch von den privaten Krankenkassen übernommen. Coaching-Dienstleistungen sind daher immer Selbstzahlerleistungen und werden Ihnen privat in Rechnung gestellt.
Je nachdem, in welchem Lebensbereich man sich beraten lässt, kann man die Kosten dafür aber unter Umständen steuerlich geltend machen (z.B. bei beruflichem Coaching) oder der Arbeitgeber beteiligt sich an den Kosten.




